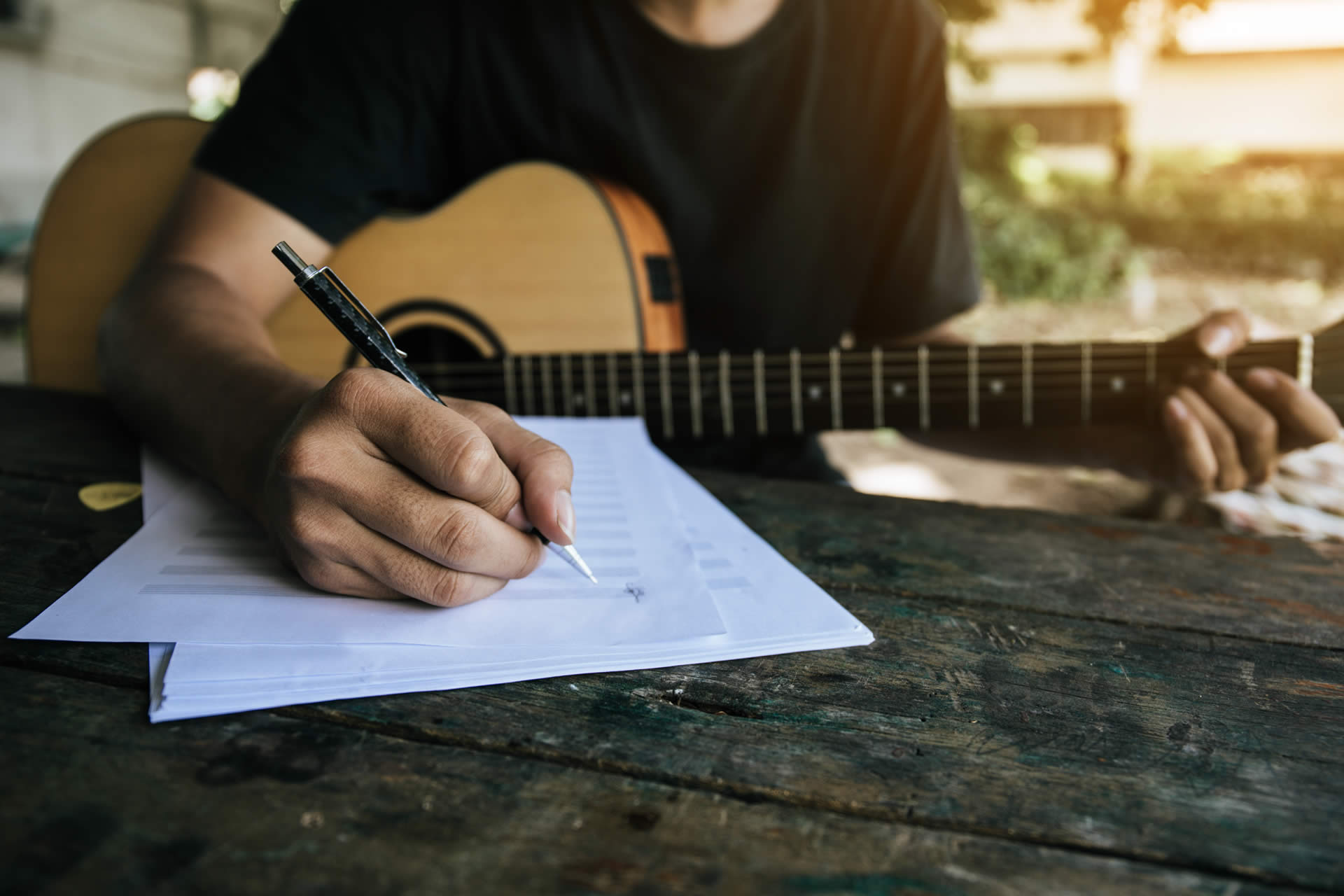
Nach langen Diskussionen konnten wir Ende März 2019 endlich eine Reform des europäischen Urheberrechtes beschließen. Nach 17 Jahren war diese Überarbeitung dringend geboten, denn das Internet und der Umgang mit geschützten Werken hat sich massiv verändert – mit erheblichen Auswirkungen auf urheberrechtliche Fragen.
Das digitale Copyright schließt die Wertelücke im Internet, die dadurch entstanden ist, dass Plattformen für die Werke auf ihren Seiten nicht haften mussten. Unser Hauptziel war dabei nicht nur, die Regeln des geistigen Eigentums an die heutige technische Entwicklung anzupassen, sondern auch die Schöpfungen des Künstlers zu unterstützen und Werke von Verlagen zu schützen. Rechteinhaber werden jetzt weitaus besser vor einer nicht autorisierten Nutzung ihrer Werke bewahrt.
Online-Plattformen, die Gewinn durch die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken machen, sollen die Verantwortung für die hochgeladenen Inhalte tragen. Die Plattformen haften künftig für die Urheberrechtsverletzungen, die auf ihren Seiten stattfinden. Diese müssen dann entweder eine Lizenz erwerben oder aber dafür sorgen, dass keine Inhalte ohne das Einverständnis des Eigentümers hochgeladen werden.
Die kann auch durch Erkennungssoftware erfolgen, die in den emotionalen Diskussionen häufig als „Upload-Filter“ bezeichnet wurde. Dies ist aber in der Sache nicht zutreffend, weil Erkennungssoftware nur auf die Daten reagiert, welche die Rechteinhaber vorher den Plattformen zur Verfügung gestellt haben. Es werden dann also auch nur diese Werke erkannt und nicht jeder Upload gefiltert.
Hier finden Sie den Text der neuen Urheberrichtlinie, ein FAQ mit den wichtigsten Fragen und Antworten zur Reform des EU-Urheberrechtes und eine kompakte Faktenübersicht zu Art. 17 (früher 13).
Neuer Bericht zu KI und Urheberrecht
Mit der rasanten Entwicklung von Künstlicher Intelligenz, insbesondere generativer Systeme wie großen Sprachmodellen, geraten grundlegende Rechte wie das Urheberrecht, aber auch Persönlichkeitsrechte oder Diskriminierungsschutz zunehmend unter Druck. Ich sehe mit Sorge, dass viele dieser Rechte kaum noch effektiv durchsetzbar sind – mit gravierenden Folgen für Kreative, Medienschaffende und unsere europäische Rechtskultur insgesamt.
Deshalb habe ich im Europäischen Parlament einen neuen Initiativbericht vorgelegt, der praktikable und faire Lösungen für das Spannungsfeld zwischen KI-Entwicklung und Urheberrecht aufzeigt. Mein Ziel: Eine rechtssichere, innovationsfreundliche und faire Regelung, von der sowohl Technologieanbieter als auch Rechteinhaber profitieren.
Die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke – etwa als Trainingsdaten – erfolgt derzeit oft ohne Lizenz oder Vergütung. Das ist nicht akzeptabel. Kreative Inhalte sind keine kostenlose Ressource. Wenn wir hier keine klare gesetzliche Grundlage schaffen, verschärfen wir nicht nur die Rechtsunsicherheit, sondern gefährden auch die wirtschaftliche Basis unserer Kreativbranche – einer Schlüsselbranche für Europas Identität und Werte.
Ich setze mich deshalb ein für:
Europa muss im globalen KI-Wettbewerb aufholen – aber nicht auf Kosten von Urhebern, Pressefreiheit und kultureller Vielfalt. Wir brauchen eigene KI-Systeme, die auf qualitativ hochwertigen, vertrauenswürdigen Daten basieren. Genau diese Inhalte liefern unsere europäischen Kreativen. Diese Leistung muss honoriert werden.
Wir brauchen keine Flickschusterei, sondern langfristige Lösungen. Eine Urheberrechtsgrundverordnung, ähnlich der DSGVO, kann ein wichtiger Schritt sein. Und wir müssen offen diskutieren, wie wir Lizenzierungen, Opt-Outs und Rechtewahrnehmung europaweit effizient gestalten – gerade angesichts weltweit operierender KI-Anbieter.
Wenn wir weiterhin zögern, schaffen wir neue Abhängigkeiten und schwächen Europas digitale Souveränität. Mein Bericht ist ein Aufruf zum Handeln – für fairen Ausgleich, klare Regeln und eine starke europäische KI-Zukunft mit und nicht gegen unsere Kreativen.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen